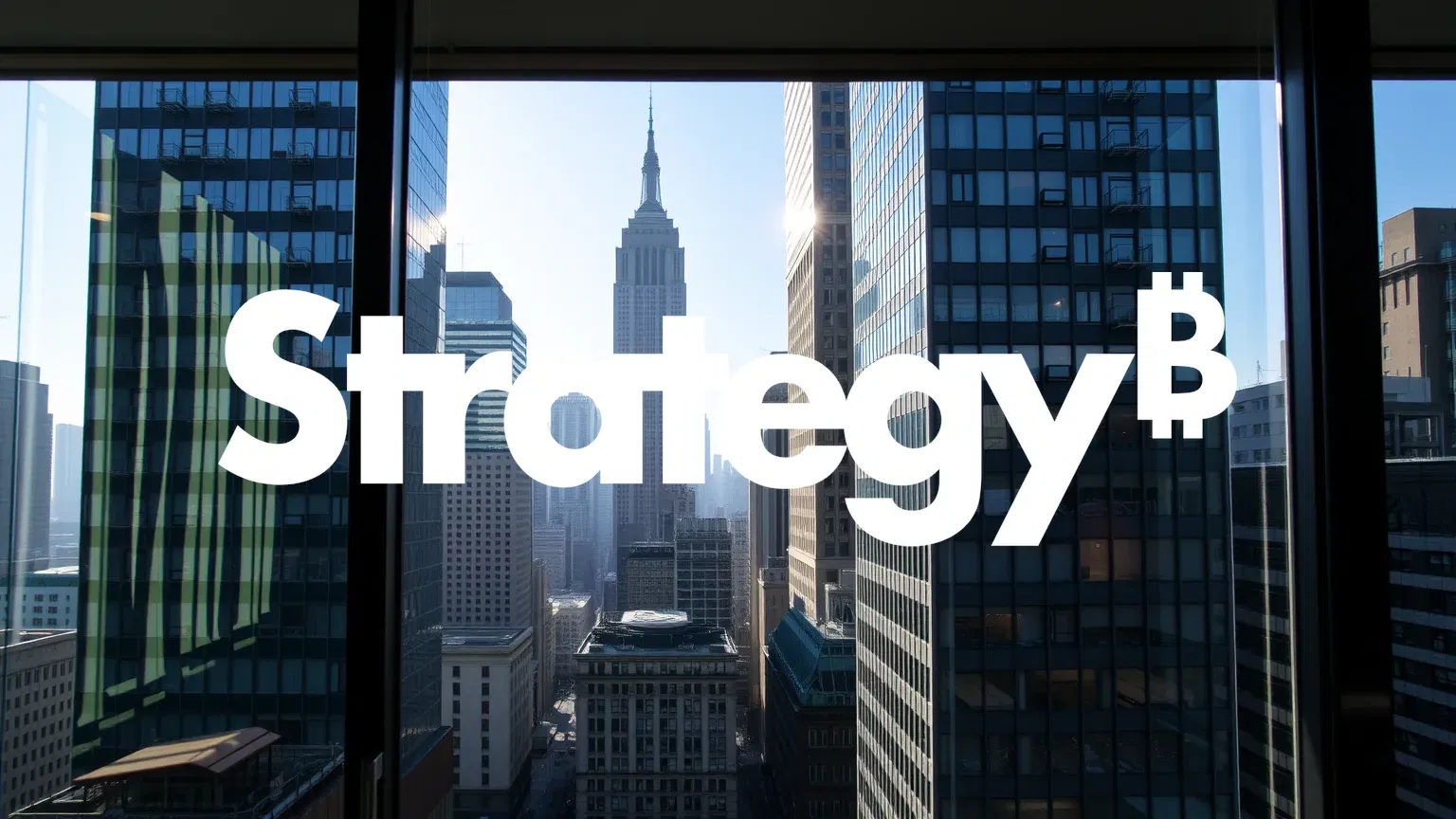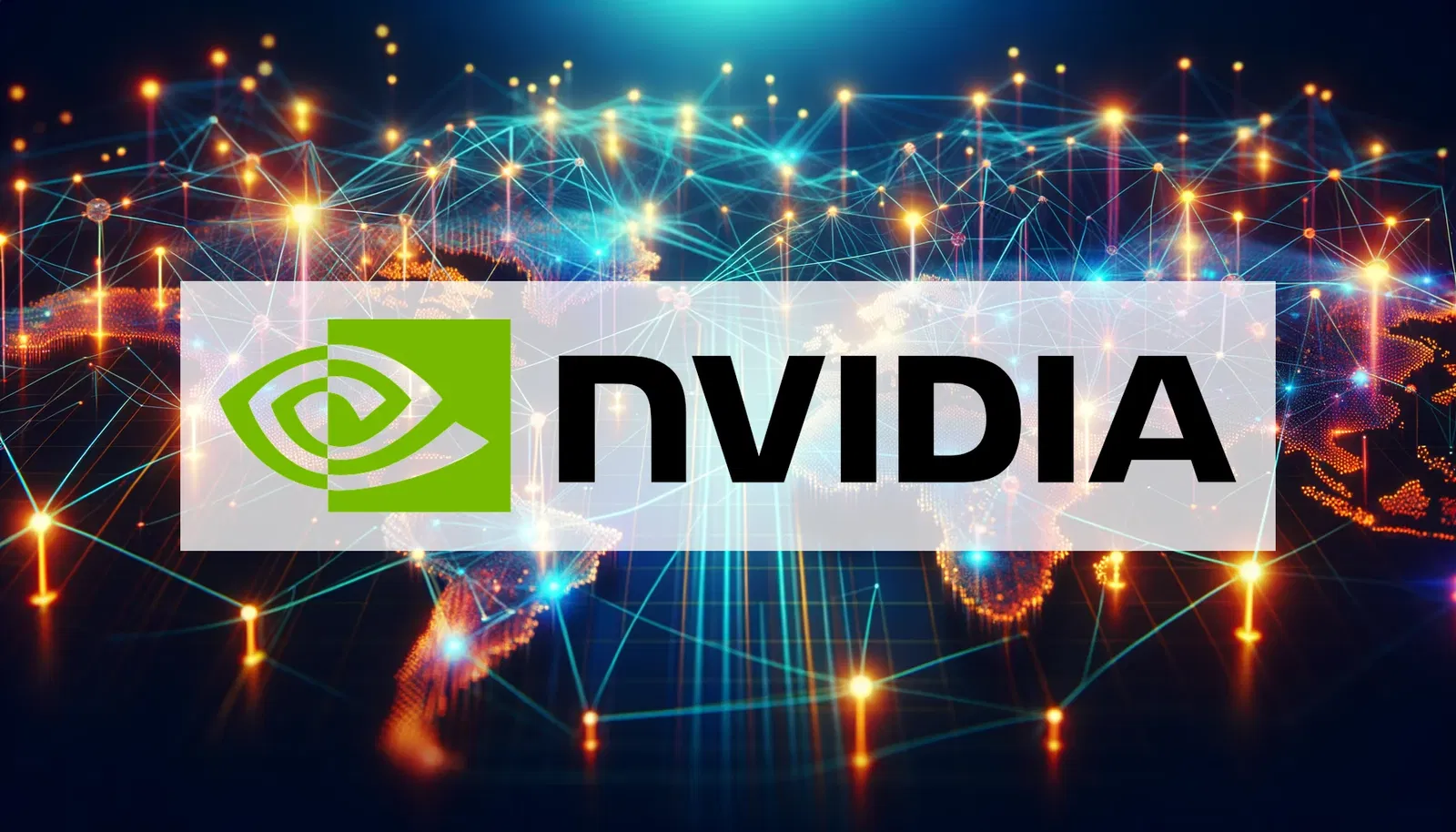Trumps Auto-Zölle bedrohen globale Märkte und pharmazeutische Deals
Die geplante Einführung von 25-prozentigen Zöllen auf Autoimporten sorgt für Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten und verzögert Übernahmen im Pharmasektor.

- Automobilbranche als primäres Ziel neuer Handelshürden
- Inflationsrisiken durch verschärfte Zollpolitik
- Pharma-Übernahmen durch politische Ungewissheit gestoppt
- Wachsende Spannungen mit wichtigen Handelspartnern
Die internationale Wirtschaft bereitet sich auf turbulente Zeiten vor, während die Trump-Administration unmittelbar vor der Ankündigung neuer Zölle auf Automobilimporte steht. Bereits heute, um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit (16 Uhr EDT), wird der US-Präsident im Oval Office eine Pressekonferenz abhalten, bei der Handelszölle für die Automobilindustrie verkündet werden sollen. Diese Maßnahme erfolgt knapp eine Woche vor der für den 2. April geplanten umfassenden Einführung von „reziproken Zöllen“ gegen Länder mit Handelsüberschüssen gegenüber den USA.
Autobranche als erstes Ziel der verschärften Handelspolitik
Die erwarteten Autozölle in Höhe von etwa 25 Prozent zielen besonders auf die Automobilindustrie in Japan, Deutschland und Südkorea – allesamt enge US-Verbündete. Im Jahr 2024 importierten die USA Automobilprodukte im Wert von 474 Milliarden Dollar, darunter Personenkraftwagen für 220 Milliarden Dollar. Die wichtigsten Lieferanten waren Mexiko, Japan, Südkorea, Kanada und Deutschland.
Trump begründet seine Zollpolitik mit der angeblich unfairen Behandlung amerikanischer Automobilexporte auf ausländischen Märkten. Besonders die Europäische Union mit ihrem 10-prozentigen Einfuhrzoll auf Fahrzeuge – viermal so hoch wie der US-Zollsatz von 2,5 Prozent für Personenkraftwagen – steht im Fokus seiner Kritik. Allerdings erheben die USA ihrerseits einen Zoll von 25 Prozent auf Pickup-Trucks aus Ländern außerhalb Mexikos und Kanadas, was diese Fahrzeuge für die amerikanischen Autobauer höchst profitabel macht.
US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte vergangene Woche gegenüber Fox Business, dass es keine Ausnahmen für die Autozölle geben werde, was Spannungen mit Ländern wie Japan und Südkorea verschärfen könnte, die Handelsabkommen mit den USA haben und keine Zölle auf US-Autos erheben.
Rechtliche Grundlage und wirtschaftliche Folgen
Die Trump-Administration wird voraussichtlich eine 2019 abgeschlossene Untersuchung zu Autoeinfuhren nach Abschnitt 232 des Handelsausweitungsgesetzes von 1962 als Grundlage für die neuen Zölle verwenden. Diese Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass „übermäßige“ ausländische Autoimporte die heimische Industriebasis schwächten und die nationale Sicherheit beeinträchtigen könnten. Obwohl Trump damals mit Zöllen von bis zu 25 Prozent drohte, setzte er sie letztendlich nicht um und ließ die Zollbefugnis aus dieser Untersuchung auslaufen.
Experten wie Ryan Majerus, ehemaliger Handelsministeriumsbeamter und jetzt bei der Anwaltskanzlei King & Spalding tätig, gehen davon aus, dass die Administration den abgeschlossenen Untersuchungsbericht mit seinen Empfehlungen nutzen könnte, um schnell Zölle einzuführen.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen könnten gravierend sein. Ein 25-prozentiger Einfuhrzoll würde die globale Automobilindustrie, die bereits unter der Unsicherheit durch Trumps wechselhafte Zolldrohungen leidet, schwer treffen. Nach Angaben des Center for Automotive Research könnten diese Zölle die Kosten für ein Auto um Tausende Dollar in die Höhe treiben, was zu einem Rückgang der Neuwagenverkäufe und Arbeitsplatzverlusten führen würde, da die US-Automobilindustrie stark von importierten Teilen abhängig ist.
Inflationsrisiken und geldpolitische Herausforderungen
Die Ankündigung neuer Zölle weckt zunehmend Sorgen über deren inflationäre Auswirkungen. Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem, warnte am Mittwoch vor dem Risiko, dass die Inflation über dem 2-Prozent-Ziel der Fed verharren oder sogar wieder ansteigen könnte, wobei steigende Einfuhrzölle potenziell zu anhaltenderem Preisdruck führen könnten.
„Ich wäre vorsichtig mit der Annahme, dass die Auswirkungen von Zollerhöhungen auf die Inflation vollständig vorübergehend sein werden oder dass eine vollständige ‚Durchschaustrategie‘ notwendigerweise angemessen sein wird“, erklärte Musalem. Bei vollständiger Umsetzung könnte eine 10-prozentige Erhöhung des effektiven US-Zollsatzes „die PCE-Inflationsrate um bis zu 1,2 Prozentpunkte erhöhen“.
Die Federal Reserve steht damit vor einem komplexen Dilemma: Einerseits könnten Zölle die Inflation anheizen und für höhere Zinsen sprechen, andererseits könnten sie das Wirtschaftswachstum verlangsamen und Zinssenkungen erforderlich machen, wie Neel Kashkari von der Minneapolis Fed einräumte.
Pharma- und Biotech-Deals stagnieren durch politische Unsicherheit
Die Handelsturbulenzen wirken sich auch erheblich auf andere Wirtschaftssektoren aus. Große Übernahmen und Fusionen im Pharma- und Biotech-Bereich stocken, während Führungskräfte mit der unberechenbaren Wirtschaftspolitik des Weißen Hauses ringen, die die Märkte erschüttert und einen globalen Handelskrieg ausgelöst hat.
Die Begeisterung über Trumps Wahlsieg Ende 2024 und die damit verbundenen Aussichten auf eine Welle von Fusionen und Übernahmen ist schnell verflogen, berichten führende Investmentbanker im Gesundheitssektor. Vorstandssitzungen, die eigentlich für Unternehmensbewertungen und Preisverhandlungen angesetzt waren, werden nun damit verbracht, verwirrte Führungskräfte durch Trumps wechselnde politische Launen zu führen.
„Sie sagen: ‚Meine Güte, das habe ich nicht kommen sehen.‘ Oder: ‚Wir haben Zölle, wir haben keine Zölle. Wir haben Zölle, wir haben keine Zölle'“, zitierte einer der führenden Dealmaker für Gesundheitswesen. „Es ist ein massiver Ablenkungsfaktor für CEOs.“
Globale Handelsspannungen verstärken sich
Die Handelsbeziehungen werden zunehmend angespannt. In einem Videogespräch mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer äußerte der chinesische Vizepremier He Lifeng am Mittwoch „ernsthafte Bedenken“ über US-Zölle und die geplanten „reziproken“ Abgaben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.
Trump hatte seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 bereits 20-prozentige Zölle auf alle chinesischen Importe verhängt und Peking vorgeworfen, nicht genug gegen den Abfluss chemischer Vorläufersubstanzen zu tun, die zur Herstellung des tödlichen Opioids Fentanyl verwendet werden. China reagierte mit gezielten Zöllen von bis zu 15 Prozent auf einige US-Waren, darunter Öl, Flüssigerdgas und landwirtschaftliche Produkte.
Auch mit der Europäischen Union bahnen sich neue Spannungen an. Der Handelskommissar der EU, Maros Sefcovic, traf sich am Dienstag mit Trumps wichtigsten Handelsvertretern, um hohe US-Zölle auf EU-Waren zu vermeiden, doch das Ergebnis blieb unklar.
Wirtschaftliche Auswirkungen bereits spürbar
Die Auswirkungen der handelspolitischen Unsicherheit zeigen sich bereits an den Finanzmärkten. Der Euro fiel am Mittwoch auf ein Drei-Wochen-Tief gegenüber dem Dollar und verlor auch gegenüber dem Yen an Wert, während Händler auf die Ankündigung der Autozölle warteten. Die europäische Gemeinschaftswährung sackte auf 1,075 Dollar ab, den niedrigsten Stand seit dem 5. März, und verzeichnete damit den sechsten aufeinanderfolgenden Tag mit Verlusten gegenüber dem Greenback.
Die Bank of America berichtete, ihre eigenen Flussdaten zeigten eine Beschleunigung der Verkäufe aus dem offiziellen Sektor – zu dem Staatsfonds und Zentralbanken gehören – von Euro gegen Dollar seit der letzten Woche. „Solche Ströme deuten darauf hin, dass der offizielle Sektor noch nicht an das Verblassen des ‚US-Exzeptionalismus‘ und die ‚europäische Renaissance‘ glaubt, die eine möglicherweise erhebliche Umschichtung in Richtung EU-Vermögenswerte auslösen könnten“, sagte Athanasios Vamvakidis, Leiter der Devisenstrategie bei BofA.
Die Verunsicherung an den Finanzmärkten könnte sich in den kommenden Wochen noch verstärken, besonders wenn die für den 2. April angekündigten umfassenden „reziproken Zölle“ in Kraft treten. Analysten wie William Pickering von Bernstein stellen fest, dass die Annahme eines „Trump-Put“ im Aktienmarkt – der Glaube, dass der republikanische Präsident alles Notwendige tun würde, um den Aktienmarkt zu stützen – sich inzwischen als falsch erwiesen hat.