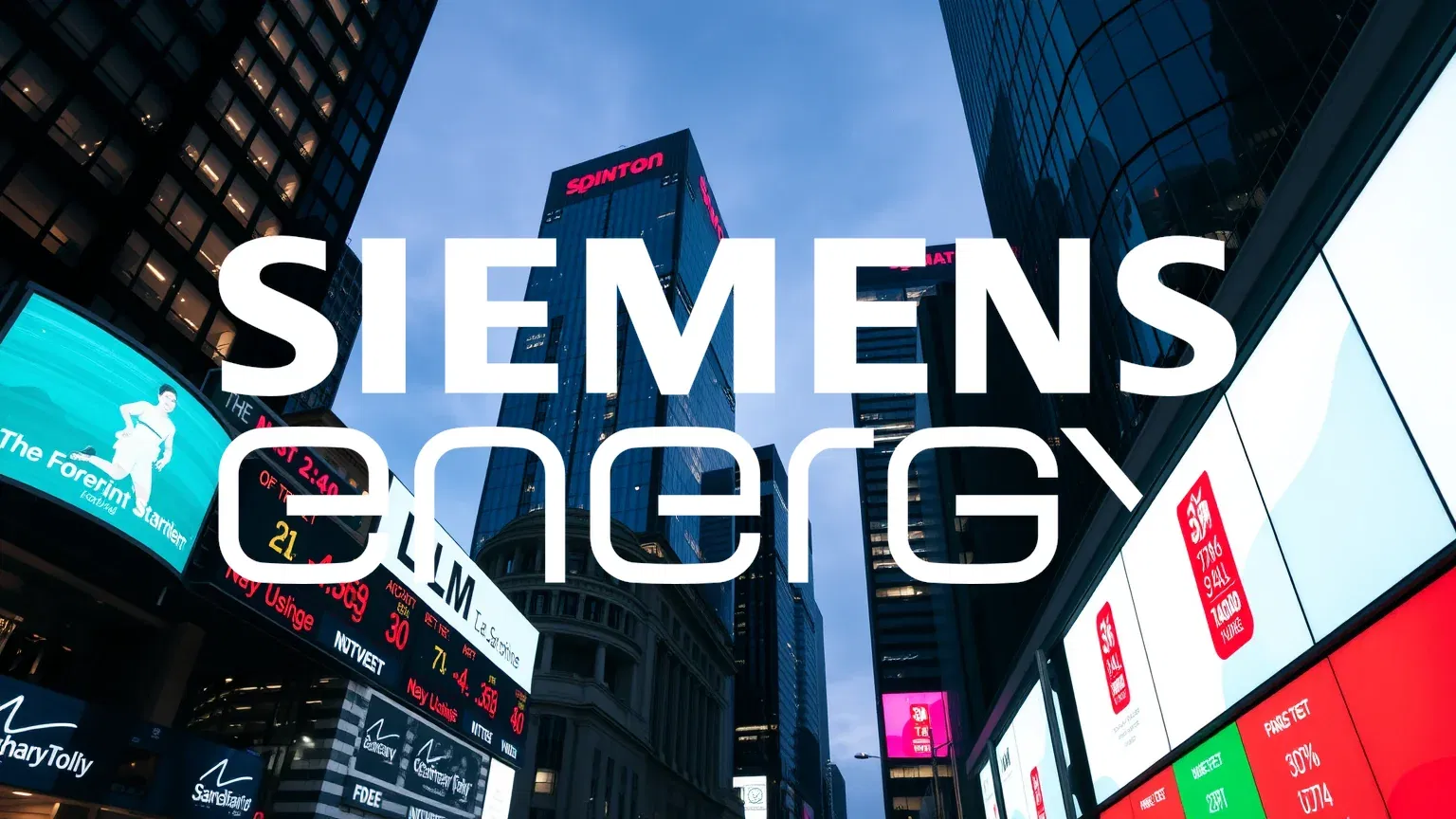Weltweite Zollpolitik erschüttert Finanzmärkte und Wirtschaftswachstum
Neue US-Importzölle verursachen Dollareinbruch und schwächere Wachstumsprognosen weltweit. Zentralbanken stehen vor dem Dilemma zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftsförderung.

- Dollar-Schwäche nach aggressiven Zollankündigungen
- Wachstumsprognosen in Europa und Asien herabgesetzt
- Gegenzölle erhöhen Risiko eines Handelskriegs
- Notenbanken überdenken Zinspolitik komplett
In einer zunehmend angespannten weltwirtschaftlichen Lage zeichnen sich die Auswirkungen der aggressiven Zollpolitik deutlich ab. Die kürzlich angekündigten US-Importzölle mit Basiszoll von 10% und spezifischen Erhöhungen für wichtige Handelspartner – darunter 20% für die EU, 24% für Japan und insgesamt 64% für China – haben globale Finanz- und Währungsmärkte stark unter Druck gesetzt.
Zollspirale und unmittelbare Marktreaktionen
Der US-Dollar erlebt seit der Ankündigung der Zollmaßnahmen eine dramatische Abwertung. Der Dollar-Index, der den Wert der US-Währung gegenüber einem Korb wichtiger Währungen misst, brach am Donnerstag um 1,9% ein – der stärkste Tagesverlust seit November 2022 – und setzte seinen Abwärtstrend auch am Freitag fort. Besonders ausgeprägt zeigt sich die Dollar-Schwäche gegenüber dem Euro, der auf den höchsten Stand seit September 2024 kletterte, sowie dem Schweizer Franken und dem japanischen Yen, die als sichere Häfen gelten.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nvidia?
„Der Vertrauensverlust in den US-Dollar ist offensichtlich“, erklärte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone. Die Deutsche Bank warnt bereits vor einer möglichen Vertrauenskrise in der US-Währung, bei der Kapitalströme fundamentale Währungsfaktoren überlagern und unkontrollierte Währungsbewegungen auslösen könnten.
China und die EU haben bereits Gegenmaßnahmen angekündigt, was das Risiko eines umfassenden Handelskriegs erhöht. Während die chinesischen Märkte am Freitag aufgrund eines nationalen Feiertags geschlossen blieben, fiel der Dollar gegenüber dem Yuan im Offshore-Handel auf den niedrigsten Stand seit dem 20. März. Auch der australische Dollar, der oft als liquider Stellvertreter für den Yuan fungiert, gab stark nach.
Globale Wachstumsaussichten trüben sich ein
Die neuen Handelshürden belasten die Wachstumsaussichten weltweit erheblich. In Indien prognostizieren Analysten eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums um 20-40 Basispunkte im laufenden Geschäftsjahr. Goldman Sachs senkte seine Wachstumsprognose für Indien von 6,3% auf 6,1%, während Citi eine direkte und indirekte Belastung von 40 Basispunkten erwartet.
Auch europäische Volkswirtschaften spüren den Gegenwind. Frankreich, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, muss seine Wachstumsprognose für 2025 nach unten korrigieren. Die französische Zentralbank hatte bereits eine Absenkung von 0,9% auf 0,7% vorgenommen. Finanzminister Eric Lombard deutete an, dass Frankreich sein Defizitreduktionsziel von 5,4% des BIP in diesem Jahr möglicherweise nicht erreichen wird.
„Bei anhaltenden Zöllen würden die Einnahmen sinken, das BIP würde sinken, was – ohne zu technisch zu werden – das Defizit verschlechtern würde. Ich denke, in diesem Fall müssen wir zum Schutz der französischen Bevölkerung akzeptieren, dass wir vom Ziel abweichen“, erklärte Lombard.
Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichneten bereits im März eine Verlangsamung des Wachstums im nicht-ölbasierten Privatsektor, was auf eine nachlassende Nachfrage in der diversifiziertesten Volkswirtschaft der Golfregion hindeutet. Der saisonbereinigte S&P Global Einkaufsmanagerindex fiel im März auf 54,0, nach 55,0 im Februar.
Zentralbanken im Dilemma zwischen Inflation und Wachstumsstützung
Die globalen Zentralbanken stehen nun vor einem schwierigen Balanceakt. Einerseits könnten die Zölle die Inflation anheizen, andererseits bedrohen sie das Wirtschaftswachstum. Für die indische Zentralbank (RBI) erwarten Analysten nun tiefere Zinssenkungen als bisher angenommen. Nachdem die RBI im Februar erstmals seit fünf Jahren die Zinsen gesenkt hatte, prognostizieren Goldman Sachs, Citi und QuantEco Research nun Zinssenkungen um insgesamt 75 Basispunkte in diesem Geschäftsjahr, was den Leitzins auf 5,5% – den niedrigsten Stand seit August 2022 – senken würde.
„Dies wäre eine angemessene Risikominimierungsstrategie angesichts der größeren Abwärtsrisiken für das Wachstum im Vergleich zu den viel geringeren Aufwärtsrisiken für die Inflation“, erläuterte Samiran Chakraborty, Chefvolkswirt für Indien bei Citi.
In Japan könnte die Bank of Japan (BOJ) ihre Normalisierungspläne überdenken müssen. Der ehemalige BOJ-Vorstand Makoto Sakurai, der noch engen Kontakt zu aktiven Entscheidungsträgern pflegt, erwartet zwar eine weitere Zinserhöhung auf 0,75% im April oder Juni, danach jedoch eine längere Pause.
„Die BOJ würde gerne die Zinsen stetig anheben und ihre massive Bilanz reduzieren. Aber sie steht vor einem schwierigen Zielkonflikt, da Trumps Zölle die Wirtschaft mit Sicherheit hart treffen werden“, sagte Sakurai. Die BOJ wird in ihren neuen Quartalsprognosen vom 1. Mai ihre Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich von 1,1% auf etwa 0,6-0,7% senken.
In Schweden rechnet Capital Economics damit, dass die Riksbank ihren Leitzins bei 2,25% belassen wird, obwohl sich die Inflationsraten unterschiedlich entwickeln. Die CPIF-Inflation (Konsumentenpreisindex für Industriearbeiter) fiel von 2,9% im Februar auf 2,3% im März, während die Kerninflation ohne Energie stabil bei 3,0% blieb.
Lebensmittelpreise und Handelsspannungen verschärfen Inflationsdruck
Die Nahrungsmittelpreise, ein wichtiger Inflationstreiber, blieben laut UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) im März stabil. Der FAO-Lebensmittelpreisindex, der monatliche Veränderungen eines Korbs international gehandelter Lebensmittel erfasst, lag im März bei durchschnittlich 127,1 Punkten gegenüber einem revidierten Wert von 126,8 im Februar. Dies bedeutet einen Anstieg von 6,9% gegenüber dem Vorjahr, liegt aber immer noch 20,7% unter dem Höchststand vom März 2022 nach Beginn des Ukraine-Krieges.
Neue handelspolitische Maßnahmen beschränken sich nicht auf die USA. Vietnam kündigte temporäre Antidumping-Zölle von bis zu 37,13% auf verzinkte Stahlprodukte aus China und bis zu 15,67% auf Produkte aus Südkorea an, die ab 16. April für 120 Tage gelten sollen. Diese Entwicklung folgt auf Forderungen des vietnamesischen Stahlverbandes nach Zöllen aufgrund des Drucks auf die heimische Stahlindustrie durch Importe aus China und Südkorea. Bereits im Februar hatte Vietnam vorübergehende Antidumping-Zölle zwischen 19,38% und 27,83% auf bestimmte warmgewalzte Stahlprodukte aus China verhängt.
Finanzmärkte suchen Orientierung
Die weltweiten Finanzmärkte zeigen sich angesichts der handelspolitischen Unsicherheit äußerst nervös. An den Devisenmärkten flüchten Anleger in traditionelle sichere Häfen wie den japanischen Yen und den Schweizer Franken. Währenddessen leidet der Dollar unter wachsendem Misstrauen.
Die Märkte haben ihre Erwartungen an die US-Notenbank Federal Reserve angepasst und rechnen nun mit vier Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte im verbleibenden Jahr 2025. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die auf Zinserwartungen reagiert, fiel am Freitag um etwa 6 Basispunkte auf 3,6611% und setzte damit den Rückgang vom Vortag um 18 Basispunkte fort.
Der heutige US-Arbeitsmarktbericht dürfte weitere wichtige Hinweise auf die Gesundheit der US-Wirtschaft und die künftige Geldpolitik liefern. Ökonomen erwarten, dass die US-Wirtschaft im März 135.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, nach 151.000 im Vormonat. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung wird Fed-Chef Jerome Powell eine Rede über die Wirtschaftsaussichten halten.
Ausblick: Anpassungsstrategien in einer fragmentierten Weltwirtschaft
Die zunehmende handelspolitische Fragmentierung zwingt Regierungen weltweit, ihre wirtschaftspolitischen Strategien zu überdenken. „Die Neuschreibung der Handelsregeln würde politische Entscheidungsträger weltweit dazu veranlassen, einen genauen Blick auf die Wiederbelebung des Binnenkonsums und der Nachfrage zu werfen“, sagte Vivek Kumar, Ökonom bei QuantEco Research. Für Indien könnte dies durch Zinssenkungen und eine schwächere Währung geschehen.
Frankreich schließt zusätzliche Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen aus, um potenzielle Wachstumseinbußen auszugleichen. In Japan vergleicht der ehemalige Zentralbanker Sakurai die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zölle mit „einem sich langsam nähernden, riesigen Eisberg. Man weiß, dass er einen hart treffen wird, und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu stoppen.“
In dieser unsicheren Weltlage könnten sich die Wachstumsdynamiken grundlegend verschieben. Während exportorientierte Volkswirtschaften besonders gefährdet sind, könnte die Stärkung der Binnennachfrage zum zentralen wirtschaftspolitischen Ansatz werden. Gleichzeitig müssen Zentralbanken ihre geldpolitischen Strategien neu justieren, um sowohl Wachstum zu unterstützen als auch Inflation einzudämmen – eine Herausforderung, die durch die aktuellen handelspolitischen Verwerfungen erheblich erschwert wird.
Nvidia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nvidia-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:
Die neusten Nvidia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nvidia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...